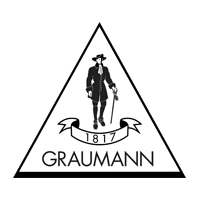Friedrich Graumann
1813
Der napoleonische Spuk war vorbei. Napoleon hatte seine letzten Schlachten verloren und dankte am 6. April in Fontainebleau ab. In Europa wuchs die Hoffnung der Menschen, dass nun wieder friedlichere Zeiten anbrechen könnten. Die kriegerischen Auseinandersetzungen waren wohl der Grund, warum Johann Friedrich lange hatte zuwarten müssen, bis er sich auf Wanderschaft begeben konnte. Nun aber, 26-jährig, war für ihn der Zeitpunkt gekommen, loszuziehen. Es zog ihn Richtung Süden.
Warum Johann Friedrich Grohmann ausgerechnet Wien als Ziel für seine „Wanderschaft“ anstrebte, war klar: in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es eine „Textilstadt“ – mit rund 30 einschlägigen Unternehmen (Webereien, Bleichereien und Färbereien). Und Österreich war ein Reich mit Entwicklungspotential.
Johann Friedrich Grohmann entschloss sich, in Wien bei Meister Andreas Schüller Webergeselle zu werden. Für seine Registrierung wählte er den Namen „Friedrich Graumann“. Ob der Wechsel von „Grohmann“ zu „Graumann“ deshalb war, weil „Graumann“ eher der oberdeutschen Sprechweise entgegenkam, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden; auch nicht, warum er „Johann“ beiseite ließ. Vielleicht wollte er hier ein ganz neues Leben anfangen. Ein Hinweis darauf ist die Tatsache, dass er um die österreichische Staatsbürgerschaft ansuchte und somit nicht vorhatte, nach Preußen zurückzukehren.
1815
Der Wiener Kongress, der vom 18. September 1814 bis zum 9. Juni 1815 unter der Leitung des österreichischen Außenministers Fürst von Metternich (1773-1859) stattfand, ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu (Grenzen und Staaten). (Quelle: Wikipedia)
1816
Am 1. Dezember 1816 wurde Friedrich Graumann die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. Einige Zeit später zog er nach Penzing (damals Hausnummer 6, heute Penzingerstraße 15).
1817
1817 war das große Jahr im Leben des nunmehr 30-jährigen Friedrich Graumann. Am 27. Jänner 1817 legte er beim „Kreisamte der Herrschaft Penzing“ den „Unterthanseid“ ab, heiratete am 16. Februar in der Rochus-Kirche eine Mitbewohnerin des Penzinger Hauses (die ebenfalls 30-jährige Josefa Posadowsky aus Tabor), trat im April als Webergeselle aus den Diensten seines Lehrherrn aus, erwarb das Webermeisterrecht und machte sich in Sechshaus selbständig. Dieses Jahr gilt als Gründungsjahr der Firma Graumann.

Friedrich Graumann (1786-1856), Ölgemälde, das posthum nach dem Totenbild angefertigt wurde. Daneben seine Frau Josefa, geb. Posadowsky (1781-1869).
1819
Am 17. April 1819 erblickte Karoline Graumann das Licht der Welt. Sie sollte das einzige Kind von Friedrich und Josefa Graumann bleiben.
1820
Währungsumstellung von Wiener Währung auf Gulden. Die schwierige Zeit der Depression ging zu Ende, der technische Fortschritt nahm wieder an Fahrt auf. Die rohe Baumwolle wurde damals noch zu zwei Drittel aus Smyrna (heute Türkei) und Saloniki (Griechenland) bezogen, nur der Rest des Bedarfs wurde durch sizilianische und amerikanische Baumwolle gedeckt. Triest war damals der Baumwollhafen von Österreich.
1825
1828
Am 23. März 1828 wurde Josef Lang durch seinen Vater als Webergeselle „freigesprochen“ und ging auf Wanderschaft. Die Lederschuhe ließ er im Rucksack, um sie zu schonen; „Holzschlapfen“ und barfuß mussten genügen.
Auch drei der Brüder von Josef Lang kamen von Mähren nach Wien: Johann 1837, Anton 1838 und Jakob 1843. Während sich Johann als Weißwaren-Webmeister in Gumpendorf (Hirschengasse 385), selbständig machte, vereinigten sich Anton und Jakob zur Firma „Gebrüder Lang“ in Fünfhaus Nr. 105. Ihnen zu Ehren wurde die Gasse im 15. Wiener Gemeindebezirk „Gebrüder-Lang-Gasse“ genannt.
1830
Traun war im Jahr 1830 noch ein Dorf. Pillwein dokumentierte in seinem Werk „Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogtums Oesterreich ob der Enns“ 57 Häuser, 469 Einwohner, 103 Wohnparteien.
1832
Im März 1832 bewarb sich Josef Lang als Webergeselle bei der Firma Graumann, wurde angestellt und durfte mit anderen Gesellen im selben Haus wohnen. Später einmal wurde er als „friedliebender, freigebiger Mensch von heiterer Natur, dabei aber doch sehr energisch und unermüdlich bei der Arbeit“ beschrieben.
1835
In diesen Jahren wurde der Teilabschnitt der Pferdeeisenbahn Budweis-Linz-Gmunden fertiggestellt. Die österreichischen Ingenieure waren damit schon reichlich spät dran – nämlich sechs Jahre nach dem legendären „Rennen von Rainhill“, bei dem sich auf der Bahnstrecke zwischen Liverpool und Manchester fünf verschiedene Dampflokomotiven-Hersteller einen Wettkampf um die schnellste Dampflok der Welt lieferten.
Der Ausbau der Bahnstrecken brachte für den Welthandel jedenfalls gewaltige Umwälzungen. Waren bisher nur Flüsse und Meeresrouten die Handelswege erster Wahl, ermöglichten die Eisenbahnen auch jenen Regionen einen wirtschaftlichen Aufschwung, die bislang abseits davon gelegen hatten. Dadurch wurde freilich auch die Konkurrenz größer – ferne Länder mischten plötzlich mit und beeinflussten mit ihren politischen Entscheidungen, ihrem Lohnniveau, der Verfügbarkeit von Ressourcen und Know-how die Märkte.
1836
Am 26. Mai 1836 wurde Josef Lang von der „Herrschaft Sechshaus“ das „Webermeisterrecht“ verliehen. Er verliebte sich in die 17-jährige Karoline – die Tochter des Chefs. Die Liebe war stark und gegenseitig; die beiden wollten heiraten. Vielleicht mussten sie auch – die Hochzeit fand nämlich zu ungewöhnlicher Stunde statt: um 6 Uhr früh, in der Reindorfer Kirche und „in aller Stille“. Als Traukleid musste Karoline einen Stoff verwenden, der gerade am Stuhl war. Nach der Trauung musste sie sich gleich umziehen und auf Veranlassung ihrer Mutter im Geschäft Ware putzen. Dass sie durch Karoline und Josef 18-fache Großeltern werden würden, hatten sich Papa Friedrich und Mama Josefa an diesem Tag wohl nicht vorstellen können; auch nicht die Tatsache, dass ihr Schwiegersohn maßgeblich dazu beitragen würde, das Unternehmen bedeutend zu vergrößern.

Karoline (geb. Graumann, 1819-1903) & Josef Lang (1812-1884) – hier um 1870. Dem aus Mähren stammenden Webergesellen gelang es – zusammen mit seinem aus Preußen stammenden Schwiegervater – in Wien eine florierende Weberei aufzubauen.
7 ihrer 18 Kinder verstarben schon in jungen Jahren. Ihr ältester Sohn (Josef Friedrich Lang), ihr 8. Kind (Wilhelm Lang), ihr 14. Kind (Eduard Lang) und ihr 18. Kind (Rudolf Lang) waren später in Leitungspositionen des Unternehmens tätig. Auch ihre sechs Töchter (Anna, Karoline, Amalia, Maria, Berta und Rosa) mussten im Betrieb mithelfen – Entlohnung und Erbe blieben ihnen aber verwehrt. Sie wurden hauptsächlich in der Spulerei, Schweiferei und Garnausgabe eingesetzt und mussten im Sechshauser Mühlbach die Wolle waschen – was eine besonders schwere Arbeit war. Zum Teil halfen sie auch im Haushalt mit.
1842
Friedrich Graumann und Josef Lang verstanden sich bestens. Das Geschäft mit den Stoffen ging gut, immer mehr Weber und Weberinnen konnten eingestellt werden. Die finanziell prekären Jahre waren zu Ende gegangen, die Chancen auf „mehr“ standen gut. Und so kaufte sich Friedrich Graumann am 30. August 1842 einen 669 Quadratmeter großen Grund auf der Sechshauserstraße – Kaufpreis: 3000 Gulden. Ende des Jahres begann er mit dem Bau eines zweistöckigen Wohnhauses. Bauzeit: 6 Monate. Es wurde das Wohnhaus für beide Familien und das Stammhaus der Firma.

Stammhaus Sechshaus 160 (Hauptstraße 21, später Sechshauserstraße 17) – Foto aus dem Jahr 1915.

Die damalige Hauptstraße ist heute die Sechshauserstraße. Parallel zur Mühlbachgasse floss der Sechshauser Mühlbach, der heute von der Ullmannstraße überbaut ist. Haus Nr. 160 (heute Sechshauserstraße 17) war Friedrich Graumann, fast gegenüber der Krongasse (später Kranzgasse), in der man auch Büros betrieb. Die Wienflussgasse (hier als Wiengasse) wurde später in Graumanngasse umbenannt und findet heute unterbrochen ihre Verlängerung westlich bis zur Einmündung in die Ullmanngasse (Kreisverkehr „Sparkassaplatz“). Dargestellt von Fritz Lang.
1845
Mitte der 1840-er Jahre beschäftigte Friedrich Graumann bereits 35 Gesellen, die alle außer dem Weblohn die Verpflegung im Haus erhielten und auch dort wohnten. Sie schliefen auf aufklappbaren Holzbänken, je zwei Mann auf einer Bank. Selbst das Brot wurde im Hause gebacken. Der Tag begann um 4 Uhr morgens, in späteren Jahren unter der Aufsicht seiner Enkelinnen.
1850
Friedrich Graumann und Josef Lang beschäftigten in Wien um die 40 Handweber, die zum Großteil im Geschäftshaus selbst, zum Teil aber auch in der Fünfhausergasse wohnten. Um die Produktion einerseits zu vergrößern und andererseits Lohnkosten zu sparen, errichteten sie um das Jahr 1850 sogenannte Faktoreien. Diese waren Subunternehmen, die exklusiv für das Hauptunternehmen arbeiteten. Der Begriff „Faktorei“ stammt aus der Kolonialzeit und stand für eine Handelsniederlassung von Kaufleuten im europäischen Ausland oder in Übersee. Der Leiter einer Faktorei wurde „Faktor“ genannt.
Die größte und zum damaligen Zeitpunkt wichtigste Faktorei befand sich in Zizelitz, wo viele gute Weber ansässig waren. Sie war bis Anfang 1894 aktiv. Man stellte dort Frottierhandtücher (ohne Jacquard), Chenille-Waren (samtartige Stoffe), Barchent (Mischgewebe aus Baumwollschuss auf Leinenkette) und Trikottücher her. Parallel zum Ausbau der Faktoreien wurde die Anzahl der Wiener Webergesellen beträchtlich eingeschränkt.
Friedrich Graumann übergab seinem Schwiegersohn mehr und mehr Führungsaufgaben, darunter auch den Schriftverkehr und die Behördenkontakte. Man begann mit dem Führen „ordentlicher Bücher“, führte ein Qualitätskennzeichen ein („Zum Herrnhuter“) und begann die Waren mit entsprechenden Etiketten zu versehen, die 1929 dann als Vorlage für eine „registrierte Schutzmarke“ dienten.

Die Bezeichnung „Herrnhuter“ stammt von der streng puritanischen Sekte der Herrnhuter, die 1722 aus Österreich vertrieben wurden und in der Lausitz Schutz und Aufnahme fand. In ihrer neuen Heimat gründeten die Herrnhuter den Ort Herrnhut, wo sie weiterhin Leinenwaren von besonderer Qualität erzeugten.
In Traun siedelten sich weitere Industriebetriebe an, darunter die Firmen Enderlin, die Brüder Berl, die Papierfabrik Dr. Feurstein, Gabler (Band und Flechtartikel) und die Essigfabrik Enenkel.
1856
Am 2. Oktober 1856 verstarb Friedrich Graumann um 1 Uhr Mittags „im Sommeraufenthalte in Mauerbach Nr. 7 bei Josef Schuster, Gastwirt in Mauerbach“ (Todesfall-Aufnahme vom k.k. Bezirksamt Burkersdorf). Todesursache: organisches Herzversagen. Sein Leichnam wurde am Schmelzer Friedhof beigesetzt (1884 aber exhumiert und in die anlässlich des Todes seines Schwiegersohnes Josef Lang errichtete Familiengruft am Hietzinger Friedhof bestattet [Grab 14/100]). Er starb ohne ein Testament aufgesetzt zu haben. Das zuständige Gericht erklärte seine Tochter als Universalerbin, nachdem seine Frau keine Erbansprüche gestellt hatte. Aus der Verlassenschaftsverhandlung geht hervor, dass Friedrich Graumann einen Aktivstand von 63.427 Gulden und einen Passivstand von 17.792 Gulden hatte – und somit zusätzlich ein Vermögen von 45.432 Gulden hinterließ.

Gemälde zum Ableben von Friedrich Graumann (1786-1856).
1857
Karoline Lang schließt am 12. November 1857 mit ihrem Mann einen Gesellschaftsvertrag ab, teilten sich das Firmenvermögen und verpflichten sich auch bei Gewinnen und Verlusten, jeweils die Hälfte zu übernehmen. Weil es keinen Gesellschaftsvertrag zum Unternehmen von Friedrich Graumann gab, wurde die Firma als „Offene Handelsgesellschaft Friedrich Graumann’s Eidam & Co.“ eingetragen. Anmerkung: „Eidam“ ist eine alte Bezeichnung für „Schwiegersohn“. Josef Lang wird als Allein-Zeichnungsberechtigter eingesetzt. Er macht sich gut. Später einmal wird er in der Familienchronik wie folgt beschrieben:
„Er hielt viel auf ein tadelloses Aeussere und war auch im Geschäfte immer gut gekleidet. Trotzdem führte er ein sehr sparsames, einfaches Leben, beispielsweise wusch er sich täglich im Winter beim Brunnen, bekleidet mit der Gattiehose. Auch war er sehr fromm. – Von der ganzen Familie wurde er mit ‚Sie‘ angesprochen, ausgenommen von seinem jüngsten Sohn Rudolf. Zu den Kindern hatte er nie ein heftiges Wort gesprochen, eher konnte schon seine Gemahlin des öfteren ein kräftiges Auszanken besorgen. Allerdings hat er sich nicht viel mit den Kindern abgegeben, denn er war fast nie zu Hause; seinen Kindern ist er auch immer fremd geblieben. Er kannte kein Vergnügen – verband auch nie Geschäftsreisen irgendwie mit Unterhaltungen – sondern lebte nur für sein Geschäft. Von früh bis abends war er rastlos tätig, das Mittagessen nahm er schnell ein und ging sofort wieder ins Geschäft. In späteren Jahren hielt er ein Mittagsschläfchen, um 6 Uhr abends wurde ihm die Suppe ins Geschäft gebracht, dann ging er jeden Tag abends in ein Gasthaus, wo er mit anderen Bürgern zusammenkam.“
Josef Langs Aufgabe war es auch, regelmäßig die Faktoreien zu besuchen. Zu dieser Zeit besaßen die Handweber zwar die Webstühle, die Zeuger, Kämme, Gallierungen und Jacquard-Karten erhielten sie jedoch aus Wien. Infolge der niedrigen Wohnungen der Faktorei-Weber standen die Jacquard-Maschinen oft auf dem Hausboden oder der Stuhl war in der Stube durch Ausgraben so tief gestellt, dass die Maschine den Plafond gerade berührte.
Die Familie veranstaltete immer wieder Feste, bei denen gesungen und getanzt wurde. Geburts- und Namenstage wurden von der ganzen Familie gefeiert; im Fasching gab es alljährlich Kostümfeste. An schönen Sonntagen unternahm man öfters Landpartien nach Ober St. Veit, Hietzing usw. Aus Sparsamkeitsgründen ging man zu Fuß. Je mehr Kinder bei diesen Unternehmungen dabei waren, umso lieber war dies dem Ehepaar Lang. Josef Lang sang dann gern Heimatlieder und alte Weisen, darunter auch diese:
I sitz auf an Stan,
und bin ganz allan,
mich friert in die Ban,
gebt’s mir an Stritzel rauf
und an Klecks Honig drauf.
1859
Das Unternehmen hatte durch Ausweitung des Absatzgebietes und vorteilhafte Immobiliengeschäfte ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftet. 1859 wurden 200.000 Gulden umgesetzt. Hauptsächlich wurden aus 350.000 Laufmeter Stoff „Sacktüchl, Kleiderleinen, Schnür-Barchent (Gewebe, das auf der rechten Seite nur Eintrag zeigt, auf der linken ein leinwandartiges Gewebe mit schmalen, flachen Längsrippen), Piqué, karierte Atlas, melierte und verschiedene andere Buntwaren“ erzeugt. Diese Arbeit wurde von rund 16 Personen geleistet (inklusive Josef Lang und Wilhelm Lang).

Seit sich Menschen mit Textilien umgaben, war ihnen deren Aussehen genauso wichtig wie deren Funktion. Mit der Entstehung der Freizeitkultur bekam der Faktor „Schönheit“ mehr und mehr Bedeutung. Foto © Textiles Zentrum Haslach / Andreas Hollinek.
1860
Die ersten Hemdenstoffe wurden um 1860 in bescheidenem Umfang erzeugt und hießen damals „85 cm Hemdleinwand Toile“. Beginn der Produktion von Badestoffen und Badetüchern. Sie wurden aus gebleichten Garnen glatt weiß hergestellt. Das Waschen dieser Artikel besorgte die Firma Brüder Steininger in der Mollardgasse 50. Gründung einer Faktorei in Saar.
In die Zeit nach 1860 fallen mehrere Ereignisse, welche die österreichische Baumwollindustrie in eine tiefe Krise stürzten. Der Übergang zum Freihandel in England hatte diesem Land in den Jahren 1850 bis 1860 einen ungeahnten Aufschwung gebracht. Sein schon vorher fest begründeter Welthandel beherrschte fünf Erdteile und seine alle freien Märkte konkurrenzlos beherrschende Industrie konnte üppige Ernten einfahren. Die Erfolge Englands verhalfen auch in Österreich freihändlerischen Tendenzen zum Durchbruch. In der Hoffnung, dass der Freihandels-Effekt auch den österreichischen Produzenten Nutzen bringen würde, wurden die Schutzzölle herabgesetzt und die Wege zum Freihandel geöffnet. Die Auswirkungen waren gravierend – ausländische Waren überschwemmten den Markt. Dazu kamen die gespannte politische Lage, die Kriegsfurcht als Folge des Krimkrieges und der Verlust der Lombardei und Venetiens, die beide wichtige Absatzgebiete gewesen waren. Um das Maß voll zu machen, brachte der Amerikanische Bürgerkrieg eine völlige Zerrüttung des Baumwollmarktes.
1861
1861 waren in Wien noch 22 Webstühle in Betrieb, die aber dann später zur Gänze eingestellt wurden. Im Wiener Haus erfolgte nur noch die Vorbereitung der Ketten, die Adjustierung und der Verkauf der Ware.

Wunderschöner Chenille-Stoff mit Farben, die bis zum heutigen Tag bestens erhalten sind.
1864
Geburt von Josef Lang am 2. April als ältester Sohn des Josef Friedrich und Amalia Lang (geb. Nemitz).
1865
Beginn der Produktion von Bettdecken. Zunächst waren es nur „Schnürldecken“, später dann auch Decken aus Piqué (Baumwollgewebe mit abwechselnd erhöhten und vertieften Stellen). Dieselben wurden in der ersten Zeit noch aus gebleichten Garnen erzeugt. Der Bedarf an Decken steigerte sich von Jahr zu Jahr, sodass nur fünf Jahre später die Kollektion bereits acht verschiedene Muster enthalten hat. Einige Jahre später wurden auch Piqué-Decken mit färbiger Unterkette erzeugt und noch sechs weitere Muster geschlagen, welche starken Absatz fanden. Außerdem wurde noch eine feinere Qualität eingeführt und die Anzahl der Muster beträchtlich erweitert.

Muster aus den Graumann-Musterbüchern im Textilen Zentrum Haslach. Foto © Textiles Zentrum Haslach / Andreas Hollinek.
1866
Am 30. April wird in Sechshaus Nr. 160 Rudolf Johann Nepomuk Lang geboren, jüngstes der 18 Kinder von Josef und Karoline Lang.
1867
Wiederholt beteiligte sich das Unternehmen an Ausstellungen. Der Höhepunkt dieser Aktivitäten war die Präsentation der Erzeugnisse auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1867. Schirmherr der Ausstellung war Kaiser Napoléon III. (1808-1873). Es war eine Ausstellung der Superlative, für die ein gigantisch großes ovales Ausstellungsgebäude am Marsfeld gebaut wurde. Die Firma Graumann gewann eine Silbermedaille, die Josef Lang mit großem Stolz in Empfang nahm.

Übersichtsgrafik zur Weltausstellung von Paris 1867. Foto © Library of Congress (www.loc.gov/pictures/resource/pga.00497) / Eugène Cicéri, Download via Wikimedia Commons.
1868
Josef Lang beschäftigte sich aber nicht nur mit der Leitung seines Unternehmens, sondern erübrigte auch noch Zeit für das Allgemeinwohl. Er bekleidete viele ehrenamtliche Ämter z.B. in der Weberinnung, als Ortsschulaufseher der Pfarrschule Sechshaus, Vorstand der Sparkasse Sechshaus, Ehrenmitglied des Sternberger Männergesangsvereins und Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Traun. Von 1868 bis 1873 war er sogar Bürgermeister von Sechshaus und dann im Gemeinderat tätig.

Chenille mit Fransensaum.
Baubeginn der Kirche „Maria vom Siege“ (mit der zweitgrößten Kuppel Wiens) auf einem ehemaligen Grundstück von Josef Lang (unweit der heutigen Gebrüder-Lang-Gasse). Das Bauvorhaben konnte erst ermöglicht werden, nachdem Josef Lang einem Grundstücktausch zugestimmt hatte. Bauzeit: sieben Jahre. Als Architekt zeichnete Friedrich von Schmidt verantwortlich, der auch das im Stil des Historismus erbaute Wiener Rathaus am Ring erbaute.