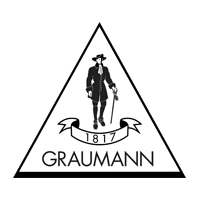Konzentration in Traun
1933
1933 brach die Firma zusammen: Überschuldung von rund 1 Million Schilling. Rudi Lang legte die Leitung der Fabrik zurück. Die Ereignisse wirkten sich derart deprimierend auf das Gemüt von Rudolf Lang aus, dass er sich gänzlich aus der Geschäftsleitung zurückzog. Seine Anteile als offener Gesellschafter behielt er bis 1939. Dipl. Ing. Willi Lang und dessen Bruder Fritz Lang übernahmen die Geschicke der Firma und konnten durch den Verkauf der Wiener Häuser und der Fabrik in Hauslau am Handelgericht den Ausgleich erreichen.
Alles, was bis dahin die Zentrale in Wien erledigt hatte, kam nun nach Traun: Musterei, Adjustierung, Versand und Buchhaltung. Ein Teil der Wiener Belegschaft musste gekündigt werden. Die Produktion war rückläufig, in Traun waren gegen Jahresende nur noch 110 Webstühle besetzt. Da eine Fortsetzung der Produktion ohne Barmittel nicht möglich gewesen wäre, suchte man nach einem Geldgeber. Man fand ihn in der Firma „Brüder Perutz“ in Prag. Die Vertragsbedingungen waren hart und enthielten weitgehende Kontroll- und Vetorechte für die Brüder Perutz, die alles daran setzten, die Firma Graumann zu übernehmen.

Fabrikseinteilung nach der Reorganisation wegen dem Wegfall der Wiener und Haslauer Produktionstätten durch den Strategen Fritz Lang persönlich.
1934
Mitte Februar 1934 münden die Konflikte der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP und Freie Gewerkschaften) mit dem Dollfuß-Regime (Republikanischer Schutzbund, Vaterländische Front, Heimatwehr) in einem Bürgerkrieg. Mehrere Hundert Tote waren zu beklagen; die meisten von ihnen unter den Arbeitern und Arbeiterinnen. Eine Verhaftungswelle und Hinrichtungen schufen zusätzliches Leid und sorgten für einen Fortbestand der politischen Instabilität im Land.

Vordruck für Rechnungen in den 1930-er Jahren. Während in Wien die Telefonnummern schon fünfstellig waren, hatte Graumann in Traun eine schlichte „3“. Später wurde daraus „103“, „3000“, in den 1990-er Jahren „73000“ und mobil „7300000“.

Logo-Entwicklung.
1935

Dipl. Ing. Willi Lang (1901-1945) 34-jährig.

Familie Lang: auf der Ladefläche sitzend in der Mitte (weißer Bart) Rudolf Lang; links neben ihm seine Frau Hedwig; rechts neben dem Lastwagen: Sohn Rudi Lang. Der Lastwagen ist ein Steyr XII – der von 1926 bis 1929 als PKW sehr beliebt war und den es auch in einer Ausführung als LKW zu kaufen gab.
1936
Im Juni 1936 kündigten die Brüder Perutz den Kredit und verlangten die gesetzliche Durchführung der Zessionen, die ihnen aber verweigert wurde. Mühsame und langwierige Rechtsstreitigkeiten nahmen ihren Lauf, die in einer Fortführung der Kreditvergabe unter weiter verschärften Bedingungen und Auflagen mündeten. Es kam zu Verpfändungen und Zwangsversteigerungen.

Graumann-Badematte.
1938
Am 12. März 1938 übernahmen die Deutsche Wehrmacht sowie SS- und Polizei-Einheiten die Macht in Österreich. Adolf Hitler wird von weiten Teilen der Bevölkerung willkommen geheißen und bei seinen Auftritten in der „Ostmark“ – wie Österreich nun heißt – bejubelt. Währungsumstellung von Schilling auf Deutsche Reichsmark. Durch den Anschluss Österreichs an das Großdeutsche Reich gingen auch die letzten Exportgeschäfte zugrunde.
Die politisch motivierte Inhaftierung von Rudi Lang und die daran anschließende kommissarische Verwaltung der Firma führte zu einem Bruderzwist. Rudi Lang wurde zum Rückzug bewogen, die beiden jüngeren Brüder als „stille Gesellschafter“ eingesetzt. Nur so konnte die kommissarische Verwaltung wieder rückgängig gemacht werden. Wirtschaftlich gesehen war der tiefste Stand in der Entwicklung der Firma erreicht. Die geänderten politischen Verhältnisse waren an die Hoffnung nach wirtschaftlichem Aufschwung geknüpft. Die neue Rechtslage und Richterschaft brachten Vorteile gegenüber den immer noch bestehenden Forderungen der Brüder Perutz. Erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges konnte man sich mit der Firma Perutz im Rahmen eines gerichtlichen Vergleiches einigen.

Josef Lang (1864-1946) acht Jahre vor seinem Tod.
1939
Rudi Lang schenkt seinen Firmenanteil an die verbliebenen öffentlichen Gesellschafter und scheidet aus dem Unternehmen aus. Typhus-Epidemie in Traun. Mehr als 300 Personen erkrankten. Die neuen Tarif-Ordnungen für Arbeiter und Angestellte brachten eine Erhöhung der Löhne und Gehälter. Der Stundenlohn für Männer betrug nun 50 Pfennig, jener von Frauen 40 Pfennig. Die Graumannsche Weberei erzeugte 150.000 Meter Stoff. Ein Jahr später sollten es – kriegsbedingt – nur noch 100.000 Meter sein. Beginn der Elektrifizierung.
1941
Beginn von Versorgungsengpässen. „Willi mußte wegen der immer schwierigeren Garnbeschaffung oft nach Berlin fahren, damals eine beschwerliche Reise.“ (aus den Aufzeichnungen von Fritz Lang).

Fritz Lang mit Sekretärin in seinem Trauner Büro.

Büromitarbeiter. Aufnahme vom April 1941. V.l.n.r.: Herr Manner sowie die Damen Haslauer, Lanzelsdorfer, Rosa und Marianne Höllhumer.
Hitler besetzte Jugoslawien und schloss Teile Sloweniens ans Deutsche Reich an. Der Krieg rückte immer näher an Österreich heran, allenorts mussten Vorkehrungen zur Verteidigung getroffen werden. Via Radio versuchte Hitler und seine Propagandamaschinerie die Aggressionen zu rechtfertigen und die Kampfbereitschaft der Soldaten zu erhalten. In den größeren Betrieben wurde den Propagandareden „des Führers“ gemeinschaftlich gelauscht. Am Foto Teile der Trauner Belegschaft am 30. Jänner 1941.

Betroffene Mienen während der Führerrede. Ganz rechts vorne: Fritz Lang, links daneben sein Bruder Dipl.-Ing. Willy Lang

Die „Graumann Kapelle“ lenkte die Belegschaft im Theatersaal in düsteren Zeiten durch Volks- und Tansmusik ab: dritter von links Trompeter Franz Stransky (Vater von Ingrid Stransky), vorletzter rechts Willi Lang (Geige) neben seinem Vater Rudolf Lang am Bass (von Ingrid Kindl zur Verfügung gestellt).
1942
Mitten im Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges, im August des Jahres 1942, feiert die Firma Graumann ihr 125-jähriges Bestehen. Im einem zur Feier einseitig bedruckten A4-Flugblatt stand geschrieben: „Inmitten des Ringens um Großdeutschlands Zukunft fällt der Gedenktag der vor 125 Jahren erfolgten Gründung unserer Firma. Lassen die großen Ereignisse auch das Interesse für den einzelnen schwinden und uns von der Herausgabe einer Festschrift absehen, so wollen wir doch auf unser Jubiläum hinweisen, um dadurch vor allem den Gründer unseres Hauses, Herrn Friedrich Graumann […] zu ehren […]. Gleichzeitig gedenken wir in Dankbarkeit unserer Gefolgschaft, die in treuer Mitarbeit die Voraussetzungen schuf, daß unser Unternehmen schwere Zeiten glücklich überstehen und eine so günstige Entwicklung nehmen konnte. Aber auch unseren vielen Geschäftsfreunden danken wir, daß sie die Qualität unserer Erzeugnisse stets geschätzt haben. Möge uns dieses Vertrauen auch in Zukunft treu bleiben und uns und unseren Nachkommen eine große, erfolgreiche Friedensarbeit beschieden sein.“
Der Winter des Jahres 1942 war überaus hart. Es gab viel Schnee und eine Eiseskälte, die dazu führte, das der Werksbach einfror und sich an den Dachrinnen der Gebäude dicke Eiszapfen bildeten. Entsprechend hart mussten auch die Arbeitsbedingungen in den Werkshallen gewesen sein.

Zugefrorener Welser Mühlbach.

Dicke Eiszapfen hängen vom Dachsims.
1944
Die Bombardements der Alliierten nahmen an Intensität zu. Zu den Zielen zählten vor allem militärische Einrichtungen, große Industrieanlagen und die gesamte Verkehrsinfrastruktur. Immer wieder wurde sowohl der Flughafen Hörsching als auch die Traunbrücken bombardiert. Das Trauner Fabriksgelände blieb hingegen weitgehend verschont – die Textilindustrie war kein militärisches Ziel. Lediglich am 19. November zählte man die Einschläge von 23 kleinen Sprengbomben. Gravierende Schäden scheinen keine entstanden zu sein, auch Menschenleben unter der Belegschaft waren keine zu beklagen.
Die Produktion ging jedoch weiter.

Die alte Dampfmaschine mit Werkmeister Franz Rader. Er sollte in den 1960-er Jahren zusammen mit Ingrid Stransky (später Kindl) beim Übergang von Produktion zu Verpachtung die wesentlichste Stütze für Fritz Lang werden.

Man beachte den liebevoll geendelten Saum der Badematten von Graumann. Foto © Textiles Zentrum Haslach / Andreas Hollinek.
1945
Ende des Zweiten Weltkrieges. Am 5. Mai 1945 erreichten die Amerikaner Traun, parkten ihre Panzer am Stuböckplatz und sprengten die Traunbrücke in die Luft. Viele Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus dem Osten Europas verlassen fluchtartig das Dorf. Eine große Anzahl der in den Lagern der Umgebung inhaftierten Menschen bittet die Bevölkerung um Wasser, Nahrung und Kleidung. Die Konflikte mit den Bewohnern von Traun eskalieren, es kommt zu Plünderungen. Beschlagnahmungen durch amerikanische Soldaten verstärken das Chaos. Karl Renner wird Ende April zum Staatskanzler bestimmt, ab 20. Dezember wurde Leopold Figl der neue Bundeskanzler von Österreich (bis 1953), Wiedereinführung des Schillings.
Österreich wird von den Alliierten in vier Besatzungszonen aufgeteilt: Vorarlberg und Nordtirol kommt unter französische Verwaltung; Osttirol, Kärnten und die Steiermark bekommen die Briten; Salzburg und Oberösterreich südlich der Donau und westlich der Enns die Amerikaner; Burgenland, Niederösterreich und Oberösterreich nördlich der Donau und östlich der Enns die Sowjets. Für die Firma Graumann und die Familie Lang bedeutet dies, dass sie nun in zwei verschiedenen Besatzungszonen verteilt war – mit all den Ungewissheiten, die dieser Umstand mit sich brachte.
Die Nachbarschaft zu Otto Graf Abensperg-Traun’s Schloss brachte es mit sich, dass Fritz Lang die wertvollsten Gegenstände von Schloss Petronell rechtzeitig in der Fabrik einlagern konnte, bevor die russische Besatzung im Osten Österreichs einmarschierte – eine langjährige Freundschaft entstand.
Am 25. Dezember 1945 verstarb Dipl. Ing. Willi Lang im Sanatorium Gmunden. Todesursache: Multituberkulose mit damit einhergehender Rippenfellentzündung. Am 29.12.1945 fand unter reger Beteiligung die Beerdigung in Traun statt. Sechs seiner Arbeiter trugen den Sarg. In den Nachgedanken an sein Leben erinnerte man sich auch an den enthusiastischen Opern-Fan Willi Lang. Gesundheitlich schon arg geschwächt, hatte er es sich nicht nehmen lassen, immer wieder im damals fensterlosen Zug zu Vorstellungen der Wiener Staatsoper zu fahren. Er war auch ein begeisterter Bergsteiger und Schifahrer gewesen. Seine Frau Helga (die später den Papierindustriellen Wolfgang Trierenberg ehelichte), beschrieb ihn als „technisches Genie“ – zumal er maßgeblich zur Modernisierung der Fabrik beigetragen hatte.
Mit dem Ableben von Dipl. Ing. Willi Lang wurde Fritz Lang der Alleininhaber der Firma Graumann – und das in einer Zeit mit schwierigsten Rahmenbedingungen. Die Nachkriegsschwierigkeiten, Rohstoff-, Strom- und Kohlenmangel verursachten große Rückschläge im Betrieb. Von Ende Dezember 1946 bis Anfang März 1947 musste er sogar stillgelegt werden.
Zwei der vielen Schutzengerln des Fritz Lang: In der 6. Klasse (1918, 16-jährig) hatte er eine schwere Operation wegen eines Blinddarmdurchbruches, durch den er monatelang mit offener Bauchdecke im Spital lag – damals eine Überlebenswahrscheinlichkeit von wenigen Prozenten. Deswegen war er zeitlebens sportlich eingeschränkt und „untauglich“. Bei einem der letzten Bombenangriffe der Amerikaner Anfang 1945 wurde zuvor im Radio durchgegeben, dass diesmal der Bahnhof Penzing unter Beschuss genommen werden würde. Frau Bilek, die damalige Haushälterin, überzeugte Fritz Lang, diesmal mit in den Luftschutzbunker zu gehen – ihre Vorahnung trügte nicht: da, wo sich sonst Fritz Lang in Sicherheit wähnte, nämlich im Parterre in der Mitte des Hauses, waren nach der Rückkehr mit Frau Bilek Granatsplitter eines Volltreffers im gegenüberliegenden Haus durch die Fenster in die Mittelmauer gedrungen – dort stehend hätte Fritz Lang nicht überlebt.

Handtuchaufhänger mit Graumann-Logo.
1946
Am 30. April feierte Rudolf Lang sen. seinen 80. Geburtstag.

Geburtstagsfeier. Der Jubilar Rudolf Lang mit seiner Frau Hedwig.
Dreieinhalb Wochen später („entkräftigt durch die Ereignisse der letzten Jahre, abgemagert und von allerlei Schmerzen geplagt“) verstarb am 26. Mai 1946 Josef Lang.
1947
Ein kurz vor dem Tod von Dipl. Ing. Willi Lang eingebrachter Rückstellungsantrag wird durch einen Vergleich abgehandelt. Rudi Lang bekommt einen 20-prozentigen Anteil als stiller Gesellschafter zugesprochen. Eine am 11. Dezember 1947 verfügte Abwertung des Schillings im Verhältnis 1:3 brachte der Firma keinen Verlust. Ein neuer PKW wird erworben – ein Steyr XX Cabriolet. Der Militärregierung wird ein 3 Tonnen LKW V8 abgekauft. Autoersatzteile und Reifen waren nur über das Ausschlachten von Autowracks zu bekommen.
1948
Den österreichischen Politikern und den Medien gelang es, Österreich als Opfer der Nationalsozialisten darzustellen. Diese historische Umkehr von Opfer- und Täterrolle bewirkte, dass das „befreite“ Österreich großzügige Unterstützung auch von Ländern bekam, die während des Krieges selbst enorme menschliche und wirtschaftliche Opfer erlitten hatten. Besonders den Hilfspaketen und der finanziellen Wirtschaftshilfe der USA ist es zu verdanken, dass sich Österreich in erstaunlich kurzer Zeit erholte. So war der perfekt konzipierte „Marshall-Plan“ ein wahrer Segen für das Land. Die öffentlichen Infrastrukturen konnten rasch wiederhergestellt und modernisiert werden.
Auch mit der Firma Graumann ging es wieder aufwärts. Die Produktion steigerte sich auf 2,5 Millionen Meter. Drei Jahre später erwirtschafteten knapp 500 Beschäftigte einen Umsatz von 23 Millionen Schilling. Es beginnt eine lange Phase des Friedens und des wirtschaftlichen Aufstiegs – einzigartig in der Geschichte Österreichs.
1949
Einsturz der zum Appreturgebäude führenden Holzbrücke und Neubau einer Brücke aus Beton (ausgelegt für 18 Tonnen Lastzug). Sukzessive Umstellung aller Lichtleitungen von 110 auf 220 Volt. Die amerikanische Militärregierung beschlagnahmt drei Luftheizapparate und transportiert sie ab.

Anschaffung eines neuen Lieferwagens – ein Austin A40. Er hatte einen 4-Zylinder-Reihenmotor, der es mit einem Hubraum von 1,2 Liter auf 40 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 114 Stundenkilometer brachte.

Der Fuhrpark in Traun mit dem Chauffeur Hermann Hutter.
1950
Am 13. Juni 1950 wollte Fritz Lang im Neuwaldegger Bad zu viert Tischtennis spielen. Weil sie aber nur zu dritt waren, suchten sie einen Vierten. „Da kam ein sehr hübsches Mädchen die Stiegen herauf und war bereit mit uns zu spielen. Sie hieß Christi Wacha.“ (aus den Aufzeichnungen von Fritz Lang). Noch im selben Jahr heirateten Fritz Lang und die damals 17-jährige Christine Wacha in der Schottenfeldkirche in Wien-Neubau.

Am 25. September 1950 brachte der Firmen-LKW die zur Adjustierung führende Brücke über den Welser Mühlbach zum Einsturz. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.
1951
Die grundlegende Änderungen in der Mode – vor allem der Damenmode – zwang Graumann, neue Kollektionen zu kreieren. Dies bedeutete nicht nur, dass Designer eingestellt werden mussten, sondern auch das Umrüsten bzw. die Neuanschaffung von Webstühlen. Um all das finanzieren zu können, fehlte aber das Geld. Einzige Lösung: Sparmaßnahmen. Der Arbeiterstand musste von 450 Arbeitern und 40 Angestellten auf 250 Arbeiter und 35 Angestellte reduziert werden. Die Monatsproduktion schrumpfte von über 300.000 Meter auf 140.000 Meter. Zur Ankurbelung des Verkaufes wurde der Verkauf reorganisiert, neue Vertreter eingestellt und die Werbe- und Marketing-Maßnahmen verstärkt (darunter auch Teilnahme an der Dornbirner Messe und der Wiener Frühjahrsmesse).

Spulerei.
1952
Um Produkte mit Herstellungsmängeln besser zu verwerten, wurde in Traun eine „Detailverkaufsstelle“ eröffnet. Dazu wurde der hintere Teil der Handweberei abgetrennt, Sanitärräume geschaffen und eine Registrierkassa angeschafft. Auch ein PKW wurde gekauft – ein Steyr Fiat 1100 E. Am Foto der Messestand von der Dornbirner Messe 1952. Damals wurde „Popelin“ stark in den Vordergrund gerückt (eine speziell strukturiertes, dicht gewobene Mischstoffart aus Baumwoll-, Leinen-, Woll- und/oder Kunstfasergarnen in Leinwandbindung); weiters Hemdenstoffe, Kleiderstoffe, Weißwaren, Flanelle, Frottierwaren, Chenillewaren und Barchente.

Graumann-Stand auf der Dornbirner Messe.
1953
Um das Kaufkraftpotential in der Metropole Wien besser zu nutzen, eröffnete Graumann in der Börsegasse 14 eine Niederlassung. Im selben Jahr erfolgte eine Wirtschaftsverfügung der Sowjetischen Kontrollkommission, die eine fünfprozentige Preissenkung auf Lebensmittel und Konsumgüter im Einzelhandel vorsah – was entsprechend ungünstige Auswirkungen auf die gesamte Textilbranche hatte. Parallel band die Kollektionsumstellung die Ressourcen. Man hatte auf Qualitätsware und besonders schöne – und entsprechend kompliziert zu webende – Muster gesetzt, deren Herstellung sich als unwirtschaftlich erwies und das Risiko von Qualitätsbeanstandungen erhöhte. Graumann erarbeitete sich zwar eine große Bewunderung und Wertschätzung bei den Kunden und Kundinnen – dennoch waren Bilanzverluste die Folge. Grundstücke mussten veräußert werden, Sozialleistungen wurden gestrichen (darunter auch das Werkbad, die Werksküche, Belegschaftsausflüge und Gefolgschaftsabende). Die unrentablen Herstellungsverfahren erschwerten auch den Export.

Graumann-Niederlassung in der Wiener Börsegasse Nr. 14 (Wien 1, Innere Stadt).
1954
Der englische Vertreter der Firma Graumann sandte ein begeistertes Telegramm: „We are very pleased to announce, that Her Majesty Elizabeth The Second, Queen of the United Kingdom, purchased two items at Harrods of London: both bathroom sets manufactured by Graumann!“. Die Königin hatte also zwei Badezimmergarnituren gekauft – mit den Motiven „Fisch“ und „Krebs“.

„Krebs“ war eine der beiden Badezimmergarnituren, bestehend aus Badematte, Badetuch, großes und kleines Handtuch sowie Waschfleck, die die englische Königin bei Harrods of London erwarb.

Krebse und andere Riffmotive als Badematte.

Das zweite Motiv für die Königin: die „Fische“ – als Badematte.
„Die ‚Schwäbische Jungfrau‘ am Graben, ‚Gunkel‘ in den Tuchlauben oder ‚Herrenhuter‘ am Neuen Markt – um nur einige in Wien zu nennen – boten das komplette Badezimmmergarnituren-Sortiment ihren qualitätsverwöhnten Kunden an und haben ganze Ausstattungen an Bettwäsche samt Monogrammen und Wappen aus den edlen Graumann-Weben nähen lassen. Die Wiener Herrenmoden Luxusgeschäfte verarbeiteten ein großes Sortiment von Popelinen [Anm.: dichtes Gewebe aus verschiedenen Garnen] der Baumwollweberei Graumann. Auch die prominenten Linzer Geschäfte wie ‚Baumgartner‘ und ‚Mally‘ kauften bei Graumann die Meterware für Hemden und Pyjamas. Der Export nach Amerika und England lief ausgezeichnet. Piquet-Sommerdecken mit eingewebten Hotelnamen fanden in Italien großen Absatz.„ (Erinnerungen von Christine Lang).
Gemüse für die Werksküche und Blumen für Dekorationen am Gelände kamen von einer eigenen Gärtnerei entlang des Madlschenterweges Ecke Fabrikstraße, deren Betrieb mit der Zeit zu teuer gekommen war. So verpachtete man sie an das frisch vermählte Ehepaar Franz und Katharina Rubenzucker, die im „Scharingerhaus“ Nr. 10 wohnten (und schließlich 11 Kinder bekamen). Mit der Zeit bauten sie deren Gärtnerei aus, die bis 2015 im südwestlichen Teil des Fabriksgeländes bestand.
1955
Am 15. Mai 1955 erfolgte die feierliche Unterzeichnung des Staatsvertrages. Österreich verpflichtete sich zur „immerwährenden Neutralität“. Im September 1955 verließen die letzten Besatzungssoldaten das Land – Österreich war frei.
Umsiedlung der Detailverkaufsstelle von der Südhalle ins „Lang-Haus“. Verkauft wurden nicht mehr nur eigene B-Waren, sondern auch zugekaufte Handelswaren. Um Linzer Kunden nicht zu „verärgern“, wurden zuerst noch keine Auslagenfenster gebaut. Jahresumsatz: rund 800.000,- Schilling.
Am 25. Dezember 1955 verschied Rudolf Lang sen. Todesursache: Schlaganfall. Nur vier Tage später schied auch seine Frau Hedwig aus dem Leben. Dazu eine berührende Anekdote (erzählt von Christine Lang, niedergeschrieben von Ingrid Kindl, geb. Stransky):
„Hedwig Lang, geb. Weingärtner, war auch schon weit über 80 und Rudolf Lang 90. Die Beiden waren unzertrennlich. Wenn einer krank wurde, gingen beide ins Spital. Schließlich wurde Rudolf Lang bettlägrig und verstarb am Weihnachtstag 1955. Seine Frau nahm das nicht weiter tragisch. Sie meinte nur: der Rudolf ist mir schon 3 Tage voraus, ich muss mich beeilen, ihn einzuholen. Und sie verstarb ganz ruhig. Als Rudolf Lang verstorben war, wurde vom Türmchen am „Herrenhaus“ eine schwarze Fahne gehisst. Drei Tage später, zur Todesstunde von Hedwig Lang, zerriss ein Windstoss die Trauerfahne. Von nun an wehten zwei Teile. Beide Särge wurden nebeneinander vor dem Altar der Trauner Kirche aufgebahrt. Es ist berührend sich vorzustellen, dass die beiden 57 Jahre zuvor vor dem selben Altar gestanden waren, um sich ihr Ja-Wort zu geben.“

Hedwig Lang (geb. Weingärtner, 1875-1955) und Rudolf Lang (1866-1955)
1956
Graumann stockt von 164 auf 226 Webstühle auf, ein Jahr später dann sogar auf 240. Mit rund 500 Beschäftigten war die Firma Graumann einer der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt Traun und des gesamten Bezirkes. Vor allem die Qualität war es, die den Graumann-Produkten den Weltmarkt eröffneten. Hemdzefire und Damenblusenstoffe übertrafen in Amerika die englische Konkurrenz. Für Luxus-Hotels in Italien wurden Piqué-Decken gewebt, Badezimmergarnituren waren in den weltbesten Kaufhäusern (wie z.B. im „Harrods of London“) zu erstehen.
Hatte Frau Lugmaier zunächst die Erlaubnis von Fritz Lang, ihr Obst und Gemüse auf einem Stand entlang des Fabrikszaunes östlich des „Lang-Hauses“ zu verkaufen, so erreichte sie bald, einen ersten Kiosk mit der Adresse Bahnhofstraße 10 bauen zu dürfen, so dass sie nicht mehr dem Wetter ausgesetzt war. Im selben Jahr baute sich die Firma Braunschmid für den Eisenwarenhandel einen Kiosk westlich des „Lang-Hauses“ (Bahnhofstraße 6). Es ließ nicht lange auf sich warten, bis Frau Bauer ihr Handarbeitsgeschäft zwischen „Lang-Haus“ und dem Kiosk von Frau Lugmaier eröffnete.

Flugzeugaufnahme vom Juni 1956. An der Bahnhofstraße links bereits der erste Obst- und Gemüse-Kiosk von Frau Lugmaier; rechts vom „Lang-Haus“ der zweite Kiosk der Firma Braunschmid (Eisenwaren).
Für Ingrid Stransky, im „Lang-Haus“ geboren und aufgewachsen, war der Weg klar, nach dem Abschluss der Handelsschule (damals mit 14 Jahren durchaus üblich) so wie ihre Mutter seinerzeit bei Graumann zu beginnen: zunächst im Expeditbüro. Schon nach zwei Jahren wird sie ins Hauptbüro versetzt, wo Fritz Lang schnell auf sie aufmerksam wurde. Ihr Stärke: Mitdenken und Kreativität! Diese Fähigkeiten halfen Fritz Lang bis ins Jahr 1975 als rechte Hand, also fast 30 Jahre lang. In dieser Zeit heiratete sie Herrn Kindl und übernahm seinen Namen.

Der Expeditleiter Herr Kurz umringt von „seinen“ Damen. Rechts Frau Brunmayr, dahinter von links 2. Dame Frau Stransky, 5. Dame ihre Tochter Ingrid und daneben Frau Königseder. (von Ingrid Kindl zur Verfügung gestellt)
Fertigstellung der Kremstalstraße von der Traunbrücke in einer neuen Trasse bis östlich vom Friedhof, wo sie in die Linzerstraße mündet.
1957
Trotz des sich immer deutlicher abzeichnenden Aufschwunges der österreichischen Wirtschaft, war es dem Unternehmen nicht gelungen, zu einer rentablen Produktion zu finden. Obwohl der Jahresumsatz auf 11 bis 15 Millionen Schilling gestiegen war, musste man am Ende des Geschäftsjahres 1957 einen Verlust von 1,5 Millionen Schilling in die Bücher schreiben. Nicht mehr benötigte Räumlichkeiten im ebenerdigen Westtrakt des „Herrenhauses“ der Trauner Fabrik, die ehemalige Werksküche, wurden an die Buchdruckerei Winopal vermietet. In diesen Tagen war Fritz Lang der erste in der Fabrik und der letzte, der nach Hause ging.