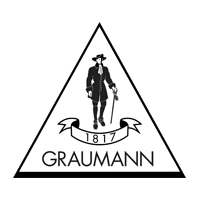Von Prof. Dr. Roman Sandgruber
Die Textilindustrie ist die Mutter aller Industrien: Erstens sind Textilien nach Nahrung und Wohnen die wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen. Zweitens zählen Spinnen und Weben zu den ältesten Fertigkeiten, die der Mensch entwickelt hat, bereits in der Jungsteinzeit. Drittens sind Spinnen und Weben ein Wunder der industriellen Technik: Aus kurzen Fasern einen langen Faden zu drehen – 5000 Jahr lang machte man das mit der Spindel. Dann wurde das Spinnrad in einem frühen Technologietransfer aus Indien nach Europa gebracht. Im späten 18. Jahrhundert, am Anfang der Industriellen Revolution, wurden die Spinnmaschinen erfunden, mit so klingenden Namen wie Jenny, Waterframe und Mule. Der technische Fortschritt in der Spinntechnik ist bis heute atemberaubend geblieben: Die Garnmenge, die ein Spinner verarbeiten kann, betrug mit der Handspindel ein halbes bis zwei Gramm pro Stunde, mit dem Spinnrad 4 Gramm, mit der Mule um 1800 ca. 400 g, mit einer Ringspinnmaschine um 1950 ca. 15 kg und mit den modernsten Open-End-Maschinen, die heute in der Linz-Textil arbeiten, ca. 400 kg.
In der Weberei ist es nicht anders: Der Schritt von den Webstühlen mit vertikaler Kette zu jenen mit horizontaler im Spätmittelalter war ein entscheidender Schritt. Während der Industrialisierung gab es viele Webstuhl-Erfinder, aber drei große Namen stehen im Vordergrund. Es sind dies John Kay, der 1733 den „Schnellschützen“ einführte, Edmund Cartwright, der 1785 den ersten mechanischen Webstuhl zum Patent anmeldete, und der Franzose Joseph Marie Jacquard, der 1805 jene grundlegende Steuerung der Webstuhlkette erfand, die es erlaubte, komplizierte Muster zu weben. Auf urzeitlichen Webstühlen mit senkrechter Kette schaffte man einige Zentimeter Gewebe pro Stunde, auf mittelalterlichen Trittwebstühlen etwa 40 cm pro Stunde und mit einem mechanischen Webstuhl um 1850 etwa 4 bis 5 Meter. Heute werden in der Linz Textil pro Tag 55 Kilometer Stoffbahnen gewebt.
Zwei Entwicklungen haben die Textilindustrie geprägt: einerseits der ungeheure Fortschritt der Textilmaschinen und der Mechanisierung und Automatisierung, andererseits das rasch wachsende Angebot an Faserstoffen, von Wolle, Flachs, Jute, Hanf und Seide, aber vor allem Baumwolle, und im 20. Jahrhundert auch die synthetischen und halbsynthetischen Fasern.
Glanz und Elend der Frühindustrialisierung
Industrie heißt auf Deutsch Fleiß. Es waren vor allem fleißige Handspinner und Handweber. Der Großraum Wien dominierte im 18. Jahrhundert die österreichischen Textilwirtschaft in den Bereichen Baumwolle und Seide, während bei Wolle Oberösterreich durch die Linzer Wollzeugfabrik führend war, mit einem der monumentalsten Fabriksbauten der Barockzeit in Mitteleuropa. Bis zu 50.000 Spinner und Weber, Spinnerinnen und Weberinnen beschäftigte diese Manufaktur am Höhepunkt im späten 18. Jahrhundert. Sie arbeiteten in Heimarbeit an Spinnrädern und Handwebstühlen in einem weiten Umkreis um Linz, im Mühlviertel, in Südböhmen, im Hausruck-, Most- und Waldviertel.
Ähnlich war es bei den sechs großen Baumwollmanufakturen der Wiener Umgebung. Die erste große Baumwollmanufaktur Österreichs wurde 1725 in Schwechat gegründet. Wie die Wollzeugfabrik in Linz bei Wolle war sie mit dem Privileg der ausschließlichen Erzeugung von Baumwollwaren ausgestattet und erreichte mit einer Spitzenbeschäftigung von über 30.000 Personen ebenfalls eine enorme Größe. In der Folge kamen eine ganze Reihe weiterer Baumwollmanufakturen hinzu, die Baumwollgewebe erzeugten, bedruckten und färbten. Die bedeutendsten neben dem dominierenden Betrieb in Schwechat waren in Kettenhof, Ebreichsdorf, Friedau, St. Pölten und Himberg angesiedelt. Zusammen werden sie als die sechs großen „Zitz- und Kottonfabriken“ der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bezeichnet. Die Seidenindustrie hingegen war über hundert Jahre hinweg der bedeutendste Wirtschaftszweig Wiens.
1801 setzte mit der Gründung der ersten großen mechanischen Spinnerei Österreichs in Pottendorf die dynamische Expansion der Fabriksspinnereien entlang der Wasserläufe im Viertel unter dem Wienerwald ein. Ein zweites Zentrum der Baumwollspinnerei entwickelte sich in Vorarlberg und im westlichen Tirol. Auch in Oberösterreich begannen entlang der Traun mechanische Spinnereien die Wasserkraft zu nutzen. Die Zahl der Handspinner, die zu Ende des 18. Jahrhunderts in Niederösterreich noch mehr als 100.000 betragen hatte, sank bis 1807 auf 8.000 und bis 1812 auf nur mehr 5.000, während bis zum Jahre 1815 über 40 mechanische Spinnereien eingerichtet wurden. Bis 1851 stieg die Zahl der Spinnereien im heutigen Österreich auf 87 mit 846.590 Spindeln und einer Garnerzeugung von über 13.000 t. Beschäftigt waren etwa 6.000 Männer, 7.000 Frauen und 3.000 Kinder unter 14 Jahren. Zur Verarbeitung dieser Garne standen in Niederösterreich und Wien 1841 rund 7.000 Webstühle zur Verfügung, davon rund die Hälfte in der Hauptstadt, ein Teil davon schon mechanisch. Aber die Handweberei spielte bis ins beginnende 20. Jahrhundert noch eine wichtige Rolle. War es das neue verbilligte Garnangebot durch die Maschinspinnerei im Viertel unter dem Wienerwald oder der Glanz der Kaiser- und Kongressstadt, die den Webergesellen Johann Friedrich Grohmann 1813 nach Wien lockten und zur Niederlassung bewogen? Jedenfalls war es der richtige Zeitpunkt. Und auch Graumann suchte in weiterer Folge zum Zweck der Mechanisierung nach Standorten an der Wasserkraft und fand einen in Traun.
Im Vergleich zur Gegenwart sind die Verhältnisse in den Fabriken um die Mitte des 19. Jahrhunderts als unzumutbar oder gar katastrophal zu bezeichnen. Die Arbeitszeit dauerte gewöhnlich von fünf Uhr früh bis acht Uhr abends, mit einer Stunde Mittagspause. Das Morgen- und Abendbrot wurde bei weiter laufenden Maschinen eingenommen, „nicht mit gänzlicher Einstellung der Arbeit, sondern in der Art, dass jeder Arbeiter nach und nach auf höchstens eine halbe Stunde sich entfernt“. Vierzehn Stunden tägliche Arbeitszeit in den Fabriken des Vormärz, von Montag bis Samstag, macht 84 Stunden pro Woche. Bei Produktionsausfällen während der Woche konnte auch eine Sonntagsarbeit angeordnet werden. Die Spinnereien waren von Kinderarbeit geprägt. Die Männer bedienten die schweren Maschinen, die Frauen steckten die Spindeln auf, die Kinder knüpften die gerissenen Fäden. Der Anteil der Kinder unter 14 Jahren an der gesamten Belegschaft lag bei etwa einem Drittel. Die Frauen machten fast 40 Prozent aus. Für Freizeit blieb nicht viel. Am Sonntag musste man in die Messe, die Kinder in die Sonntagsschule. Das Quartier musste man in unmittelbarer Betriebsnähe nehmen, sonst war das zeitlich nicht zu schaffen. In der Fabrik gab es Staub, Hitze, feuchte Luft, Lärm. Die Wohnverhältnisse waren katastrophal. Auch bei Graumann wurde 1871 noch 14 Stunden pro Tag gearbeitet, von fünf Uhr früh bis 20 Uhr, mit einer Stunde Mittagspause, sechs Tage in der Woche. Vor Kriegsbeginn waren 10 Stunden, also 60 Stunden pro Woche, die Norm, bis im Jahr 1918 die 48 Stunden-Woche eingeführt wurde.
Von der Blüte zur Krise
Die Textilindustrie konnte auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre Dynamik beibehalten. Dem um die Mitte des 19. Jahrhunderts schon hoch entwickelten Spinnmaschinenbau folgte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine ähnliche Entwicklung bei den Webmaschinen. Der mechanische Webstuhl war schneller und qualitätssicherer als die handbetriebenen Modelle, und ein Weber konnte statt nur eines Stuhls zwei bis vier Maschinen bedienen. Durch das Aufkommen der Webautomaten nach dem Ersten Weltkrieg wurde es möglich, 20 bis 30 Webmaschinen von einem Weber bedienen zu lassen. Von 1850 bis 1900 war die Textilindustrie immer noch die Branche mit der höchsten Beschäftigung, wenn sie auch in der Dynamik mit den neuen Industrien wie Elektrizität, Chemie und Fahrzeugbau nicht Schritt halten konnte. Die Arbeitsbedingungen wurden rasch besser. 1919 wurden der Acht-Stunden-Tag und die 48-Stunden-Woche Gesetz.
Um 1910 gab es in der Habsburgermonarchie etwa 130 Baumwollspinnereiunternehmen mit etwa 200 Standorten, und etwa 550 Webfabriken. Die Industrieunternehmer bildeten das Kernstück der Wiener Ringstraßengesellschaft. Sie stellten im Jahr 1910 mehr als ein Drittel der Wiener Millionäre. Und sie produzierten jene Güter, die den Reichtum des Wiener Fin de Siècle möglich machten und seine Modernität begründeten: von Rübenzucker und Lagerbier über Textilien, Seifen und Chemikalien bis zu Tafelgeschirr, Essbesteck, Fahrrädern, Automobilen, Aufzügen und Elektrogeräten. Millionär konnte man in nahezu jeder Branche werden. Doch mehr als ein Drittel der Spitzenverdiener in der Industrie, insgesamt 119, waren Textilindustrielle. 97 dieser 119 Textilmillionäre waren jüdischer Herkunft. Es ermöglichte ihnen, sich am Bau der Ringstraßen-Palais zu beteiligen, soziale Einrichtungen breit zu unterstützen und den Künsten und Wissenschaften großzügige Förderungen zukommen zu lassen.
Es gab traditionsreiche Familien wie die Leitenberger, deren großer Konzern vom böhmischen Cosmanos den Ausgang nahm und der 1904 nach dem tragischen Verkehrsunfall des letzten Leitenberger in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden war, und Aufsteiger wie Isidor Mautner, der 1867 mit einem Hundegespann in Wien begonnen hatte, die Erzeugnisse des von seinem Vater gegründeten Webereiunternehmens zu vertreiben. 1905 wandelte er seine Betriebe mit Hilfe der Boden-Credit-Anstalt in die „Österreichischen Textilwerke AG“ um und fasste sie 1912 in einer Holding zusammen. Isidor Mautner war damit Generaldirektor und Haupteigentümer eines Konzerns mit 42 Fabriken und etwa 23.000 Beschäftigten, 650.000 Spindeln und mehreren tausend Webstühlen geworden. In der Weltwirtschaftskrise von 1929 brach sein Reich in einem dramatischen Konkurs zusammen. Mehrere berühmte Persönlichkeiten der österreichischen Kulturgeschichte kommen aus der Textilindustrie: etwa die Dichter Hermann Broch und Stefan Zweig, deren Väter unter den Wiener Textilmillionären des Jahres 1910 zu finden sind, oder Lilly Lieser, die Mäzenin Arnold Schönbergs. Zu den 1000 Wienern mit den höchsten Einkommen im Jahre 1910 zählten auch die Brüder Wilhelm und Rudolf Lang. Beide versteuerten im Jahr 1910 jeweils Jahreseinkommen von knapp über 100.000 Kronen. Es war der Höhepunkt der Firma Graumann und die letzte große Blütezeit der österreichischen Textilindustrie. Der Umsatz des Unternehmens war von 1901 bis 1910 von 600.000 Kronen auf drei Millionen angewachsen. Das Unternehmen beschäftigte rund 1.400 Personen. Produziert wurden über 2 Millionen Laufmeter Stoff auf 964 Hand- und Maschinwebstühlen. Die Liste der Exportmärkte war breit gestreut. Ausschlaggebend war die Qualität.
Der Erste Weltkrieg und seine Folgen waren für die österreichische Textilindustrie und auch Graumann verheerend. Während des Krieges verknappten sich wieder einmal die Rohstoffe. Wie nie zuvor wurden mögliche Ersatzfasern gesucht. Experimente mit Torfwolle, Bohnenranken, Weinreben und Lupinen waren nicht erfolgreich. Jene mit Fasern aus Brennnesseln und Papier zeigten zwar Teilerfolge, erlangten aber für die Praxis keine nachhaltige Bedeutung. Auch bei Graumann wurde Papier zu Papiergeweben verarbeitet.
Dem Österreich der Ersten Republik blieben mit 1.171.000 Spindeln 25 Prozent der Spindeln und mit rund 12.000 Webstühlen 9 Prozent der Webstühle der Habsburgermonarchie erhalten. Einer viel zu großen Spinnkapazität stand eine viel zu kleine Webkapazität gegenüber. In den Folgejahren wurde die Zahl der Spindeln auf 875.000 reduziert und die Zahl der Webstühle auf 16.700 erhöht. Aber die Branche war bleibend geschwächt. Zwischen 1925 und 1929 ging es noch einmal aufwärts, auch bei Graumann, vor allem mit Frottee- und Frottierwaren. Doch die 1929 ausbrechende Weltwirtschaftskrise traf die Textilindustrie hart. Es wurde wenig investiert und wenig konsumiert. Zahlreiche Unternehmen wurden geschlossen. Auch Graumann geriet in eine dramatische Schieflage.
Der Zweite Weltkrieg verschlechterte die Situation noch weiter. Wieder fehlten die Rohstoffe und die Produkte waren wenig kriegswichtig. 1939 erzeugte die Graumannsche Weberei 150.000 Meter Stoff. Ein Jahr später sollten es – kriegsbedingt – nur noch 100.000 sein. 1941 waren die Engpässe in der Versorgung schon dramatisch. Der Luftkrieg beeinträchtigte auch die Textilindustrie, auch wenn diese nicht das Hauptziel der Angriffe bildete.
Am Nachkriegsaufschwung konnte die zum größeren Teil in der sowjetisch besetzten Zone konzentrierte Textilindustrie wenig teilhaben. Zuerst bestimmte der Faser- und Brennstoffmangel die Situation. Die für die Textilindustrie vorgesehen Marshall-Plan-Mittel kamen fast ausschließlich den westlichen Besatzungszonen zugute. Das war einer der Gründe, dass das kleine Vorarlberg von einem klaren zweiten Platz hinter Niederösterreich zu einem ebenso klaren ersten Platz in der österreichischen Textilindustrie aufstieg. Vorarlberg überholte, wenn auch nicht bei der Zahl der Beschäftigten, so doch deutlich bei den Kapazitäten den Großraum Niederösterreich. Auch für Oberösterreich südlich der Donau, das zur amerikanischen Zone gehörte, war die Konstellation günstig. Es gab im Wirtschaftswunder der frühen fünfziger Jahre nochmals einen kurzen textilindustriellen Aufschwung. Auch Graumann konnte mit seinem oberösterreichischen Standort vorerst davon profitieren. Das Unternehmen beeindruckte durch Qualität, sowohl in den Wiener Luxusgeschäften wie auch in Italien und den USA und selbst im Londoner Nobelkaufhaus Harrods. Doch rasch zeichnete sich ab, dass preislich auf den Weltmärkten nur mehr schwer zu bestehen war. 1958 zog Graumann die Konsequenz und stellte, um Schlimmeres zu vermeiden, die Produktion ein.
Im Jahre 1955 beschäftigte die österreichische Textilindustrie im Vergleich zu den anderen Industriesektoren immer noch die meisten Arbeitnehmer, verlor diese Position aber schon zu Ende des Jahrzehntes. Es folgte ein industrieller Abbau, der in seiner Dramatik nur mit dem industriellen Aufbau in der Startphase der Industrialisierung verglichen werden kann. Hatte die österreichische Textilindustrie ihren heimischen Markt 1955 noch zu 88 Prozent versorgt, so waren es 1975 nur noch 53 Prozent. Im Jahr 2004 waren es noch 18 Prozent, und die Tendenz ist weiter fallend.
An Innovation hatte es der Branche weiterhin nicht gefehlt. In den Sechzigerjahren wurden die Schützenstühle zunehmend durch die modernen Greifer- und die neuen Projektilwebstühle mit einer deutlichen Leistungssteigerung abgelöst. In den Siebzigerjahren kam der Luftwebstuhl praxisreif zum Einsatz, der durch Entfall zahlreicher bewegter mechanischer Teile im Schusseintrag schlagartig eine Leistungssteigerung um fast 100 Prozent brachte. Noch revolutionärer waren die neuen Openend-Maschinen, die bei der Garnerzeugung pro Spindel eine mindestens fünfmal höhere Produktion erbrachten, allerdings bei einem für viele Applikationen etwas niedrigeren Qualitätsstandard im Vergleich zur Ringspindel. In den Neunzigerjahren hielten die Elektronik und die Computersteuerung in raschem Tempo Einzug in den Textilmaschinenbau. Dies ermöglichte eine enorme Verbesserung beim materialschonenden Arbeiten, was die Leistung und Qualität und auch den Bedienungskomfort für Arbeiter und Meister spürbar erhöhte. Die Umstellung von der Lochkarten- auf die Elektroniksteuerung beim Jacquard-Webstuhl, der für modische und anspruchsvolle bemusterte Gewebe zum Einsatz kommt, hat dessen Produktionsleistung um rund 50 Prozent erhöht.
Trotz all dieser technologischen Sprünge, welche die Kapitalintensität der Textilindustrie dramatisch erhöht haben, war der Niedergang der Branche in Europa und den USA nicht zu stoppen. Die Lohnvorteile der Niedriglohnländer, oft ergänzt durch wirtschaftspolitische Lenkungsmaßnahmen, ermöglichten in diesen Ländern Erzeugungskosten und damit Produktpreise, die in der industrialisierten Welt nicht darstellbar waren. Drei Viertel der bedeutenden Textilunternehmen Österreichs sind in den vergangenen 50 Jahren liquidiert worden, die meisten im 4. Quartal des vergangenen Jahrhunderts und meistens durch Konkurse.
Fritz Lang hat mit seinem Schritt, die Produktion bereits im Jahr 1958 zu schließen, also durchaus Weitblick bewiesen: Ein Konkurs wurde vermieden und damit nicht nur niemand geschädigt, sondern auch der Weg zu anderen Aktivitäten offen gehalten und ermöglicht.