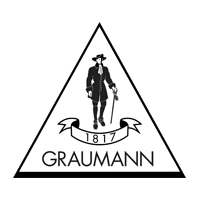Vorzeit
790
Der Name Traun schien erstmals um 790 n. Chr. als Traun urkundlich auf. Diese Flussbezeichnung ist keltischen Ursprungs und dürfte sich von der Wurzel „dru“, was soviel wie laufen oder fließen bedeutet, herleiten. In einer Traditionsurkunde (die Aufzeichnung einer Schenkung), die in die Zeit zwischen 813 und 824 datiert, erfolgte die erste urkundliche Erwähnung als Ort. (Quelle: „Oberösterreichische Nachrichten“, Sonderbeilage Traun vom 23.10.1981).
1525
Erstmalige Erwähnung der „Wincklmyll“ im Kopialbuch von Hörsching (damals Heresing, zweite Erwähnung 1609) im Landesarchiv Linz, deren Ursprung ins Jahr 1471 zurückreichen.

Dieser Mühlstein wurde bei Abbruch einer Hauptmauer des „Herrenhauses“ gefunden, stammt vermutlich von der Winkelmühle und befindet sich auf der Nordseite vom „Magazin“. (Foto: Arrigo Wunschheim).
1669
1674

Schloß Traun auf Welser-Haid – Stich von Georg Matthäus Vischer, 1674 – handkoloriert
Von 1756 bis 1763 hatten einander alle europäische Großmächte erbitterte Schlachten geliefert. Da er auch in Kolonialgebieten ausgetragen wurde, wird er von vielen Historikern auch als ein Weltkrieg bezeichnet. Die Kämpfe fanden mit den Friedensschlüssen von Paris und Hubertusburg am 14. Oktober 1786 ihr Ende. Friedrich der Große (1712-1786) wurde stark und förderte die kulturellen und wirtschaftlichen Aktivitäten; darunter auch den per Edikt verfügten Bau einer Weberkolonie zu Kloster Zinna. Durch Ansiedlung von „Kolonisten“ (hauptsächlich Handweber aus Oberlausitz) und allerlei Sozialleistungen gefördert, erhoffte man von den Webern und Weberinnen einen wichtigen Beitrag für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Mit der Entwicklung mechanischer Webstühle verloren sie jedoch zunehmend an Boden – der erhoffte Reichtum blieb aus (Quelle: Beitrag „Die Webersiedlung“ auf www.kloster-zinna.com).
Maria Theresia (1717-1780), Gemahlin von Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen, Erzherzogin von Österreich, Königin von Ungarn, und später ihr Sohn Kaiser Joseph II. (1741-1790) verfügten zahlreiche wirtschaftliche und soziale Reformen: viele Städte bekamen ein Marktrecht und Fördermaßnahmen – so auch Spinnereien, Webereien, Färbereien und Bleichereien. Die Rohstoffe für die hergestellten Textilien waren Schafwolle und der zu Leinen verarbeitete Flachs. Ab der Kolonialzeit und der mit ihr einhergehenden Ausweitung des globalen Handels erlangte Baumwolle mehr und mehr an Bedeutung.